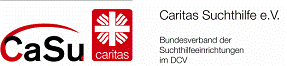|
|
Qualitätsmanagement- rahmenhandbuch |
|
||||
|
|
||||||
|
|
Prävention 1. Bereich Prävention
ist ein umfassender Ansatz, der insbesondere Maßnahmen, die eine
Entstehung von Suchtkrankheiten verhindern sollen, beinhaltet. Grundgedanke
der Prävention ist somit die Förderung der Gesundheit des Menschen
und nicht nur die Fokussierung auf mögliche Risikofaktoren der Suchtentwicklung.
Der Ansatz der Suchtprävention orientiert sich vor allem an suchtprotektiven
Bedingungen, die das Gesundheitsverhalten aller Altersgruppen positiv beeinflussen.
Primäre
Suchtprävention setzt im Vorfeld einer Abhängigkeitsgefährdung
an und beginnt im frühesten Kindheitsalter (Kindergarten, Vorschule). In
diesem Bereich wird in erster Linie mit Multiplikatoren und
substanzunspezifisch gearbeitet. Wesentliche Ziele der
Primärprävention sind die Gesundheitserziehung und -förderung,
die positive Entfaltung der Persönlichkeit, die Entwicklung eines stabilen
Selbstwertgefühls sowie die Förderung sozialer, kognitiver und
emotionaler Kompetenzen zur Bewältigung allgemeiner Lebensaufgaben. Heute
wird im Bereich der Prävention zwischen Verhaltens- und
Verhältnisprävention unterschieden. Verhaltensprävention richtet sich auf
das individuelle Verhalten der Menschen. Sie will gesundheitsriskante
Lebensweisen vermeiden und gesundheitsfördernde Lebensweisen
fördern. Verhältnisprävention will gesundheitsschädliche
Umwelteinflüsse verringern und eine gesunde Lebens- und Arbeitswelt schaffen. Suchtpräventiven
Maßnahmen sollen ursachenorientiert, zielgruppenspezifisch,
ganzheitlich und lebensweltbezogen ausgerichtet sein, sowie in langfristige und
kontinuierliche Prozesse eingebunden und auf Vernetzung angelegt sein. Zielgruppen
suchtpräventiver Maßnahmen können sein: - Kinder
und Jugendliche - Eltern - Lehrer - Erzieher - Multiplikatoren
/ Mediatoren - Jugendarbeiter - Vorgesetzte - Personen
mit riskantem Konsum - An
Prävention Interessierte 2. Qualitätsmerkmale • Prozessbeschreibung
und -verantwortung - In welcher Form
(Prozessbeschreibung, Verfahrensanweisung) ist der Prozess Prävention
beschrieben und dokumentiert (z. B. Ziele und Zweck, Zielgruppe,
Geltungsbereich, Umfang / Dauer, Ablauf)? - Sind die
Prozessverantwortlichen benannt und für ihre Aufgaben qualifiziert? - Sind die Teilprozesse
(z. B. Einzelveranstaltungen, Projektangebote, Schulung und Beratung von
Multiplikatoren) sowie die wesentlichen Ziele der Prävention (z. B.
Abstinenz von oder kritischer Umgang mit psychotropen Substanzen,
Informationsvermittlung, Förderung von suchtprotektiven Maßnahmen)
festgelegt und beschrieben? - Sind in der
Prozessbeschreibung die Bedürfnisse und Interessen der verschiedenen
Kundengruppen (z. B. Kinder- und Jugendliche, Personen mit hohem Risiko der
Entwicklung von schädlichem Konsum oder einer Abhängigkeit,
Bezugspersonen, Multiplikatoren / Mediatoren) entsprechend berücksichtigt
und beschrieben (z. B. Unterstützung von Bezugspersonen, Gesundheitserziehung
und -förderung, sachliche und qualifizierte Information)? • Kooperation aller an der
Umsetzung des Prozesses beteiligten Mitarbeiter - Ist die
Prozessbeschreibung Prävention allen an der Umsetzung Beteiligten in der
aktuellen Fassung zugänglich und bekannt? - Gibt es eine Struktur
und Verfahrensweise, in der die Abstimmung zwischen den beteiligten
Fachkräften zur Optimierung des Präventionsprozesses geregelt ist? - Wie wird die Zusammenarbeit
zwischen dem beteiligten Personal innerhalb der Einrichtung und den externen
Kooperationspartnern (z. B. Schulen, Kindergärten, Betrieben, Gemeinden,
erlebnispädagogischen Einrichtungen, Jugendzentren) gewährleistet? • Überprüfung
der Wirksamkeit von Prozessen - Sind die zentralen
Kennziffern des Präventionsprozesses definiert und werden sie
regelmäßig auf ihre Aussagekraft hin überprüft (z. B.
Nachfrage nach spezifischen Angeboten, Erhebungen zur Kundenzufriedenheit,
Anzahl der Beschwerden, positive Rückmeldungen in der Fachöffentlichkeit)? - Wird die Wirksamkeit des
Präventionsprozesses anhand der festgelegten Kennziffern
regelmäßig durch Vergleich mit eigenen Prozessen und Vergleich mit
Prozessen in anderen Einrichtungen überprüft (Benchmarking)? • Änderung
von Prozessen / Prozessentwicklung - Gibt es in der
Einrichtung ein festgelegtes System, mit dessen Hilfe der Prozess
Prävention regelmäßig und systematisch kontrolliert wird und
die Prozessbeschreibung mit all ihren Bestandteilen fortgeschrieben wird (z.
B. Überprüfung der Einhaltung der Verantwortlichkeiten in der
Durchführung des Präventionsangebotes, regelmäßiges
Review und Aktualisierung der Prozessbeschreibung)? - Ist die kontinuierliche
Verbesserung und Weiterentwicklung des Präventionsprozesses innerhalb
der Einrichtung am Vergleich mit eigenen Prozessen und mit Prozessen in
anderen Einrichtungen orientiert (Benchmarking)? - Werden Kundenerwartungen
zur Klärung z. B. des Informationsbedarfes sowie der Gestaltung des
Präventionsprozesses mittels systematischer Erhebungen (Fragebögen,
Beschwerden) erfasst? - Werden die systematisch
erhobenen Informationen von Mitarbeitern, Kunden, anderen Interessengruppen
und Wettbewerbern verwendet, um Ziele für die Verbesserung des
Präventionsprozesses festzulegen? - Stellt die Einrichtung
sicher, dass die Wirksamkeit des Präventionsprozesses einer komplexen
Ursachenanalyse unterzogen wird, die zu einer Weiterentwicklung des Prozesses
führt? - Gibt es beschriebene
Methoden zur Einführung oder Änderung des Präventionsprozesses
(z. B. Ableitung von konkreten Maßnahmen aus der Analyse der
Kennziffern in Qualitätszirkeln, Verfahrensweise zur Änderung der
Prozessbeschreibung, Berücksichtigung aktueller wissenschaftlicher bzw.
empirisch gesicherter Erkenntnisse zu dem jeweiligen Bereich, beispielsweise
Information über das erhöhte Komorbiditätsrisiko bei Langzeitkonsumenten
von Cannabis)? |
|||||
|
|
||||||
|
|
Bearbeiter/in |
Version |
Erstellungsdatum |
Seite
(Druckversion) |
||
|
|
|
|
2.0 |
04/2011 |
3 (Kap.3) |
|